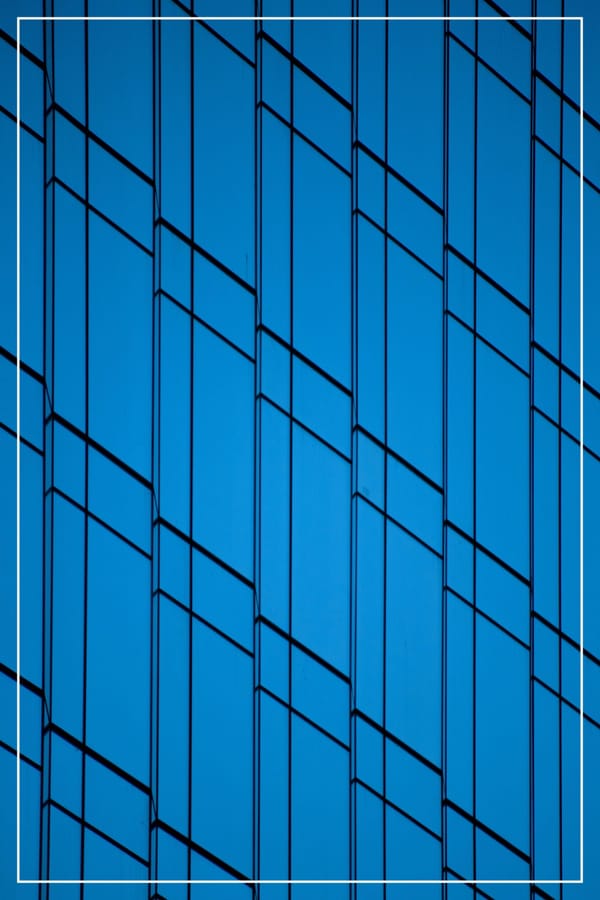Die 3 Ebenen der Macht: Warum brillante Strategien scheitern – und wie Sie alle drei Ebenen durchschauen
Die meisten Führungskräfte analysieren nur formale Macht. Aber das ist nur die Oberfläche. Darunter liegen informelle Macht und Agenda-Macht. Wer alle drei Ebenen versteht, kann strategisch agieren.

Organisationen sind keine rationalen Systeme.
Sie sind politische Systeme.
Und in politischen Systemen funktioniert Macht auf drei Ebenen gleichzeitig.
Die meisten Führungskräfte sehen nur eine davon.
Das ist der Grund, warum fachlich überlegene Vorschläge scheitern – während politisch geschickte Kollegen mit schwächeren Ideen durchkommen.
Wenn Sie verstehen wollen, wie Macht in Ihrer Organisation wirklich funktioniert, müssen Sie alle drei Ebenen durchschauen.
Macht ist nicht eindimensional
Wenn Sie an "Macht" denken, denken Sie wahrscheinlich an:
- Titel
- Hierarchie
- Entscheidungskompetenz
- Budget
Das ist formale Macht.
Also das, was im Organigramm steht. Das, was in Stellenbeschreibungen definiert wird.
Aber das ist nur die Oberfläche.
Darunter liegen zwei weitere Ebenen. Ebenen, die nirgendwo dokumentiert sind. Ebenen, die darüber entscheiden, ob Ihre Strategie fliegt oder stirbt.
Ebene 1:
Formale Macht –
Das offizielle Spiel
Das ist die Ebene, die jeder sieht und analysiert:
- Wer hat welchen Titel?
- Wer berichtet an wen?
- Wer hat Budget- und Personalverantwortung?
- Wer hat formal das letzte Wort?
Das ist die Welt der Organigramme, Stellenbeschreibungen und Unterschriftenregelungen.
Beispiel:
Der Vorstand Finanzen muss zustimmen.
Die Geschäftsführung entscheidet.
Der Aufsichtsrat genehmigt.
Alles klar. Alles dokumentiert.
Das Problem mit Ebene 1:
Sie beschreibt, wer theoretisch Macht hat.
Sie sagt nichts darüber, wer sie tatsächlich ausübt.
Warum Ebene 1 trügerisch ist:
Ein CEO hat formal absolute Macht.
Aber:
- Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende ihn nicht unterstützt, ist er verwundbar
- Wenn sein Vorstand geschlossen gegen ihn arbeitet, ist er isoliert
- Wenn die Aktionäre misstrauisch werden, ist er austauschbar
Formale Macht ist fragil.
Sie existiert nur so lange, wie die informellen Strukturen sie stützen.
Ebene 2:
Informelle Macht –
Das unsichtbare Spiel
Das ist die Ebene, die unter der Oberfläche arbeitet:
- Wessen Meinung zählt wirklich – unabhängig vom Titel?
- Wer hat direkten, privilegierten Zugang zu den Entscheidern?
- Wer kontrolliert, welche Informationen nach oben gelangen?
- Wer kann Projekte verzögern, ohne Nein zu sagen?
- Wer muss konsultiert werden, bevor irgendetwas passiert?
Das ist die Ebene der Netzwerke, Beziehungen und Informationsflüsse.
Das sind die Machtzentren, die nicht im Organigramm stehen.
Typische Quellen informeller Macht:
1. Privilegierter Zugang
Der langjährige Assistent des CEOs.
Der alte Schulfreund im Vorstand.
Der ehemalige Chef, der jetzt Aufsichtsrat ist.
- Sie haben keinen formalen Titel.
- Aber sie haben das Ohr der Macht.
2. Kontrolle über Information
Der Controller, der die Zahlen aufbereitet.
Die Stabsstelle, die alle Vorlagen schreibt.
Der IT-Chef, der "technische Machbarkeit" bewertet.
- Sie entscheiden nicht formal.
- Aber sie kontrollieren, was Entscheider sehen.
3. Institutionelles Gedächtnis
"Das haben wir schon mal versucht. Hat nicht funktioniert."
"Ich war hier, als der alte CEO das eingeführt hat."
"Ich kenne die Historie dieses Themas."
- Sie haben keine formale Autorität.
- Aber sie definieren, was "realistisch" ist.
4. Netzwerk-Position
Der Bereichsleiter, der mit allen anderen Bereichsleitern befreundet ist.
Der VP, der in allen wichtigen Gremien sitzt.
Die Direktorin, die jeden im Vorstand persönlich kennt.
- Sie können Koalitionen schmieden.
- Sie können Informationen streuen.
- Sie können Widerstände organisieren – oder auflösen.
Was auf Ebene 2 wirklich passiert:
Szenario:
Eine neue Führungskraft übernimmt.
Formal: Sie hat volle Entscheidungsmacht.
Realität: Ein langjähriger Mitarbeiter kontrolliert alle Informationen, kennt alle relevanten Akteure persönlich, sitzt in allen wichtigen Gremien.
Was passiert?
Die Führungskraft will Veränderungen durchsetzen.
Der langjährige Mitarbeiter sagt nicht Nein.
Aber:
- Die Zahlen, die nach oben gehen, zeigen "unerwartete Risiken"
- Wichtige Stakeholder bekommen "Bedenken" zugespielt
- Meetings werden "aus terminlichen Gründen" verschoben
Formale Macht trifft auf informelle Macht.
Informelle Macht gewinnt.
Ebene 3: Agenda-Macht –
Das versteckte Spiel
Das ist die tiefste Ebene:
- Was will jeder Stakeholder wirklich?
- Welche persönlichen Ziele verfolgen sie?
- Welche Ängste steuern ihr Verhalten?
- Wer profitiert von welchem Ausgang?
- Welche Loyalitäten und Verpflichtungen gibt es?
Das ist die Ebene der verborgenen Agenden.
Das ist das, was niemand ausspricht.
Das ist das, was in keinem Meeting-Protokoll steht.
Typische versteckte Agenden:
1. Karriere-Ängste
"Wenn dieses Projekt scheitert, bin ich der Schuldige."
- Konsequenz: Risiko-Minimierung wird wichtiger als Erfolg.
- Symptom: Endlose "Absicherungs-Schleifen" und Verzögerungen.
2. Territoriale Interessen
"Wenn diese neue Abteilung erfolgreich ist, verliere ich an Bedeutung."
- Konsequenz: Sabotage durch passive Blockade.
- Symptom: "Wir unterstützen das voll – aber leider haben wir gerade keine Ressourcen."
3. Persönliche Loyalitäten
"Mein Mentor hat dieses System aufgebaut. Ich kann nicht dagegen stimmen."
- Konsequenz: Emotionale Bindung übertrumpft rationale Argumente.
- Symptom: Widerstand, der sachlich nicht erklärbar ist.
4. Finanzielle Eigeninteressen
"Wenn dieses Budget-Modell kommt, verliere ich Kontrolle über mein Budget."
- Konsequenz: Zero-Sum-Denken blockiert Kooperation.
- Symptom: "Grundsätzlich gute Idee – aber die Details stimmen noch nicht."
5. Angst vor Veränderung
"Ich verstehe die neue Technologie nicht. Wenn sie kommt, bin ich überflüssig."
- Konsequenz: Status Quo wird mit allen Mitteln verteidigt.
- Symptom: "Das ist alles zu komplex. Lass uns erst mal eine Studie machen."
Das Problem mit Ebene 3:
Niemand spricht seine versteckte Agenda offen aus.
Stattdessen werden sachliche Argumente vorgeschoben:
- "Zu hohe Kosten"
- "Technische Risiken"
- "Falscher Zeitpunkt"
- "Strategische Bedenken"
Aber die wahren Gründe liegen woanders:
- Angst vor Machtverlust
- Territoriale Verteidigung
- Persönliche Loyalitäten
- Karriere-Risiken
Wer nur auf die sachlichen Argumente reagiert, löst das Problem nicht.
Wer die versteckte Agenda adressiert, kann den Widerstand auflösen.
Warum die meisten scheitern:
Sie sehen nur die Oberfläche
Die typische Herangehensweise:
- Problem identifizieren
- Lösung entwickeln
- Organigramm checken: "Wer muss zustimmen?"
- Präsentation vorbereiten
- Formale Zustimmung einholen
- Umsetzung starten
Was fehlt?
→ Analyse von Ebene 2: Wer hat informelle Macht?
→ Analyse von Ebene 3: Welche versteckten Agenden gibt es?
Das Ergebnis:
Das Projekt wird blockiert.
Nicht offen. Sondern durch:
- "Ressourcen-Engpässe"
- "Terminliche Verschiebungen"
- "Unerwartete Komplexität"
- "Notwendige Absicherungen"
Nach 6-12 Monaten ist das Projekt tot.
Und Sie verstehen nicht, warum.
So analysieren Sie alle drei Ebenen systematisch
SCHRITT 1: Stakeholder identifizieren
Wer ist relevant für Ihr Projekt?
- Formale Entscheider
- Formale Vetospieler
- Informelle Einflussnehmer
- Betroffene (auch ohne formale Rolle)
Erstellen Sie eine vollständige Liste.
Nicht nur die offensichtlichen.
Auch die, die "formal nicht zuständig" sind – aber informell Einfluss haben.
SCHRITT 2: Alle drei Ebenen kartieren
Für jeden Stakeholder:
| Stakeholder | Ebene 1: Formale Macht | Ebene 2: Informelle Macht | Ebene 3: Versteckte Agenda |
|---|---|---|---|
| CFO | Zustimmung erforderlich | Direkter Zugang CEO, 20 Jahre | Will Budgetkontrolle behalten |
| IT-Direktor | Nur "beratend" | Sitzt in allen Tech-Gremien | Angst vor Machtverlust |
| VP Ops | Formal Projektleiter | Neu, kein Netzwerk | Will sich beweisen |
| Vorstand X | Formal neutral | Informelle Autorität | Loyalität zu altem System |
Jetzt sehen Sie das komplette Bild.
SCHRITT 3: Strategie für jede Ebene entwickeln
Für jeden Stakeholder:
Ebene 1 (Formale Strategie):
- Wie spreche ich die formale Rolle an?
- Welche Zustimmungen brauche ich?
Ebene 2 (Informelle Strategie):
- Wie nutze ich das Netzwerk?
- Wen muss ich VOR der formalen Entscheidung einbinden?
Ebene 3 (Agenda-Strategie):
- Wie adressiere ich die versteckte Agenda?
- Wie nehme ich Ängste?
- Wie mache ich aus einem Gegner einen Verbündeten?
Beispiel CFO:
- Ebene 1: Formal um Zustimmung bitten (Standard-Präsentation)
- Ebene 2: Einzelgespräch mit CEO vorher → CFO briefen lassen
- Ebene 3: Gemeinsame Budgetkontrolle anbieten → Angst vor Machtverlust nehmen
SCHRITT 4: Die richtige Reihenfolge
KRITISCH:
Wer die Ebenen in der falschen Reihenfolge angeht, scheitert.
Falsche Reihenfolge (typisch):
- Ebene 1: Formale Präsentation vorbereiten
- Ebene 1: Meeting mit Entscheidern
- Ebene 2 & 3: Überraschung über Widerstände
Richtige Reihenfolge:
- Ebene 3: Versteckte Agenden adressieren
→ Einzelgespräche
→ Ängste verstehen
→ Interessen ausgleichen - Ebene 2: Informelle Koalitionen schmieden
→ Schlüsselpersonen einbinden
→ Informelle Zustimmung sichern
→ Widerstände auflösen - Ebene 1: Formale Entscheidung herbeiführen
→ Meeting
→ Präsentation
→ Beschluss
Wenn Sie ins Meeting gehen, muss die Entscheidung bereits gefallen sein.
Das Meeting ist nur noch die formale Bestätigung.
Der Unterschied zwischen politischer Naivität und politischer Meisterschaft
Politische Naivität:
- Sie glauben an die Macht der besseren Argumente
- Sie analysieren nur formale Strukturen
- Sie präsentieren im Meeting
- Sie treffen auf unerwarteten WiderstandSie verlieren
Politische Meisterschaft:
- Sie verstehen alle drei Ebenen
- Sie adressieren versteckte Agenden im Vorfeld
- Sie bauen informelle Koalitionen
- Sie gehen ins Meeting mit gesicherter Mehrheit
- Sie gewinnen
Das ist der Unterschied zwischen Reaktion und Gestaltung.
Zusammenfassung: Die 3 Ebenen der Macht
Ebene 1: Formale Macht
- Wer entscheidet laut Organigramm?
- Titel, Hierarchie, Budget
Ebene 2: Informelle Macht
- Wer entscheidet wirklich?
- Netzwerke, Zugang, Information
Ebene 3: Agenda-Macht
- Warum entscheiden sie so?
- Ängste, Interessen, Loyalitäten
Die meisten analysieren nur Ebene 1.
Die Erfolgreichen nutzen alle drei.
Ihr nächster Schritt
Nehmen Sie Ihr wichtigstes aktuelles Projekt.
Stellen Sie sich drei Fragen:
- Ebene 1:
- Wer hat formal Entscheidungsmacht?
- Ebene 2:
- Wer hat informelle Macht – ohne im Organigramm zu stehen?
- Ebene 3:
- Was will jeder dieser Stakeholder wirklich?
- Welche Ängste haben sie?
Wenn Sie dabei Unterstützung brauchen:
Über den Autor:
Markus Krahnke ist Executive Coach für Macht- und Stakeholder-Dynamiken. 25 Jahre Erfahrung als Lobbyist und Politikberater (Vattenfall, Bundestag). Heute zeigt er Führungskräften, wie Macht in Organisationen wirklich funktioniert – ohne Werte zu opfern.