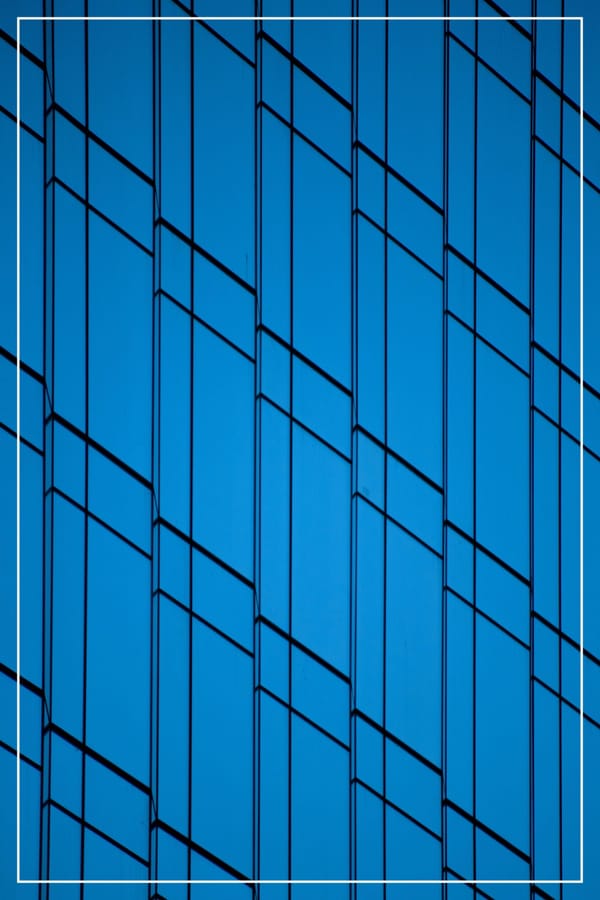Wie Macht wirklich funktioniert - jenseits der Lehrbuch-Theorie
Warum klassische Macht-Modelle versagen und wie Macht in modernen Organisationen wirklich funktioniert: durch Abhängigkeit, Information und Koalitionen.

Die meisten Führungskräfte scheitern nicht an mangelnder Kompetenz. Sie scheitern, weil sie Macht falsch verstehen.
Sie haben gelernt, dass Macht aus fünf Quellen kommt: Position, Belohnung, Bestrafung, Expertise, Charisma. Sie haben gelernt, dass man Macht "hat" wie einen Werkzeugkasten. Sie haben gelernt, dass gute Argumente und solide Fakten ausreichen, um Entscheidungen zu beeinflussen.
All das ist falsch.
Nicht theoretisch falsch. Sondern praktisch irrelevant für die Realität deutscher Organisationen.
Das amerikanische Erbe
Die klassischen Macht-Modelle stammen aus den 1950er Jahren. French und Raven entwickelten ihre fünf "Bases of Power" in einer Zeit, in der Organisationen hierarchisch, stabil und überschaubar waren. Ihre Kategorisierung war für damalige Verhältnisse brillant: Sie machte Macht analysierbar, lehrbar, greifbar. Deshalb wird sie bis heute in Leadership-Programmen gelehrt.
Aber sie beschrieb eine Welt, in der ein Vorgesetzter tatsächlich weitgehend autonom entscheiden konnte. In der Informationen langsam flossen und Netzwerke lokal begrenzt waren. In der Macht vertikal organisiert war, nicht horizontal vernetzt.
Diese Welt existiert nicht mehr.
Moderne Organisationen sind Matrixstrukturen. Entscheidungen entstehen in Gremien, nicht an Schreibtischen. Informationen fließen in Echtzeit. Macht ist nicht mehr vertikal organisiert, sondern horizontal vernetzt.
Trotzdem werden die alten Modelle weiter gelehrt. In MBA-Programmen, in Leadership-Seminaren, in Coaching-Ausbildungen. Als wären sie zeitlose Wahrheiten.
Sie sind es nicht.
Die drei Macht-Illusionen
Illusion 1: Position = Macht
Das klassische Modell behauptet: Je höher Ihre Position, desto mehr Macht haben Sie. "Legitimate Power" nennt man das.
Die Realität: Position gibt Ihnen formale Befugnisse. Aber formale Befugnisse bedeuten nicht automatisch faktischen Einfluss.
Beispiel: Der neu ernannte Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft. Auf dem Papier hat er umfassende Entscheidungsbefugnisse. In der Praxis muss er sich mit Konzernvorgaben, Betriebsrat, einflussreichen Altgedienten und informellen Machtzentren arrangieren. Seine Position verschafft ihm Legitimität - aber nicht die Fähigkeit, etwas durchzusetzen.
Oder: Die Projektleiterin einer strategischen Initiative. Sie hat keinerlei Weisungsbefugnis. Trotzdem bestimmt sie faktisch die Richtung, weil alle Informationen über sie laufen und sie die Koalition der Unterstützer aufgebaut hat.
Position ist nicht irrelevant. Aber Position allein ist nicht Macht.
Die entscheidende Einsicht: Position, Expertise oder Durchsetzungsfähigkeit sind keine Machtquellen per se. Sie werden nur dann zu Macht, wenn sie Abhängigkeiten erzeugen. Ein Titel ohne faktische Kontrolle über Ressourcen ist wertlos. Fachwissen ohne strategische Positionierung verpufft. Durchsetzung ohne Koalition erzeugt nur Widerstand.
Illusion 2: Expertise = Einfluss
Das zweite klassische Modell: "Expert Power". Wer am meisten weiß, hat am meisten Macht.
Das ist gefährlich naiv.
In komplexen Organisationen gibt es immer mehrere Experten mit widersprüchlichen Einschätzungen. Der IT-Experte sagt: "Wir brauchen System A." Der Datenschutzexperte sagt: "System B ist rechtlich sicherer." Der Finanzexperte sagt: "System C ist kosteneffizienter."
Alle drei haben recht - aus ihrer jeweiligen Perspektive. Wer setzt sich durch?
Nicht der mit der besten Expertise. Sondern der, der die politische Konstellation versteht. Der weiß, welche Argumente beim CEO verfangen. Der die richtigen Allianzen geschmiedet hat. Der seine Expertise strategisch einsetzt, nicht nur fachlich.
Expertise verschafft Ihnen Gehör. Aber nicht Durchsetzung.
Illusion 3: Durchsetzung = Macht
Die dritte Illusion ist subtiler. Viele Führungskräfte glauben: Macht zeigt sich darin, dass ich meinen Willen durchsetze. Je öfter ich "gewinne", desto mächtiger bin ich.
Das Gegenteil ist der Fall.
Die mächtigsten Menschen in Organisationen müssen sich selten durchsetzen. Warum? Weil sie Konstellationen so gestalten, dass ihre Lösung als die logische, alternativlose erscheint.
Sie inszenieren keine Machtproben. Sie vermeiden sie.
Der französische Soziologe Michel Crozier hat es prägnant formuliert: Macht wird erst sichtbar, wenn sie fehlt. Solange sie funktioniert, erscheint sie als natürliche Ordnung der Dinge.
Wenn Sie ständig Überzeugungsarbeit leisten müssen, wenn Sie gegen Widerstände ankämpfen, wenn Sie Kompromisse aushandeln - dann sind Sie nicht mächtig. Dann sind Sie in einem Machtkampf gefangen.
Wahre Macht ist unsichtbar. Sie zeigt sich nicht in spektakulären Siegen, sondern darin, dass bestimmte Fragen gar nicht mehr gestellt werden.
Wie Macht tatsächlich funktioniert
Wenn die klassischen Modelle nicht greifen - was bestimmt dann, wer in Organisationen wirklich Macht hat?
Nach 25 Jahren in Politik und Konzernen habe ich drei Prinzipien identifiziert:
Prinzip 1: Macht entsteht aus Abhängigkeit
Sie haben Macht über jemanden, wenn dieser auf Sie angewiesen ist. Nicht formal - faktisch.
Das ist keine neue Erkenntnis. Schon Pfeffer und Salancik haben in den 1970er Jahren gezeigt: Organisationen werden nicht durch formale Hierarchie gesteuert, sondern durch Ressourcenabhängigkeiten. Wer kontrolliert, was andere brauchen, hat Macht.
Das kann viele Formen annehmen:
- Sie kontrollieren Ressourcen, die andere brauchen (Budget, Personal, Informationen)
- Sie haben Zugang zu Entscheidern, den andere nicht haben
- Sie besitzen Wissen, das nicht dokumentiert ist und sich nicht einfach übertragen lässt
- Sie können Prozesse beschleunigen oder verlangsamen
- Sie haben die Legitimation bei kritischen Stakeholdern (Betriebsrat, Aufsichtsrat, Kunden)
Die entscheidende Frage ist nicht: Welche Titel habe ich? Sondern: Wer ist auf mich angewiesen - und wofür?
Ein Controller ohne Führungsverantwortung kann mächtiger sein als ein Abteilungsleiter - wenn er als einziger die Budgetlogik durchschaut und jede strategische Entscheidung durch seine Einschätzung muss.
Prinzip 2: Macht entsteht aus Information
In stabilen, hierarchischen Organisationen war Information symmetrisch verteilt. Alle wussten ungefähr gleich viel, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
In modernen, vernetzten Organisationen ist Information asymmetrisch. Manche wissen Dinge, die andere nie erfahren werden. Manche verstehen Zusammenhänge, die anderen verborgen bleiben.
Entscheidend ist heute nicht mehr, wer oben in der Hierarchie sitzt, sondern wer an den Knotenpunkten der Kommunikation positioniert ist. Wer zwischen verschiedenen Bereichen vermittelt, wer in mehreren Gremien sitzt, wer Zugang zu unterschiedlichen Informationskreisen hat - der sieht das Gesamtbild, während andere nur Ausschnitte kennen.
Ein Beispiel: Die Leiterin Strategische Projekte hat formal wenig Entscheidungsbefugnis. Aber sie sitzt in der Steuerungsgruppe für Digitalisierung, im Kernteam für die Reorganisation und berichtet direkt an den CFO. Sie erfährt frühzeitig, welche Budgets gekürzt werden, welche Bereiche fusioniert werden sollen, wo politische Widerstände entstehen. Während andere Führungskräfte in ihren Silos agieren, versteht sie die Gesamtdynamik - und kann ihre eigenen Projekte entsprechend positionieren, bevor andere überhaupt realisieren, was sich anbahnt.
Macht hat, wer früher und besser informiert ist. Nicht nur über offizielle Entscheidungen, sondern über:
- Inoffizielle Stimmungen und Meinungen
- Kommende Veränderungen, bevor sie kommuniziert werden
- Die tatsächlichen Prioritäten der Entscheider (vs. die offiziell kommunizierten)
- Konflikte und Allianzen im Hintergrund
- Die informellen Regeln, nach denen Entscheidungen wirklich fallen
Wer diese Informationen hat, kann antizipieren. Wer antizipieren kann, kann gestalten. Wer gestalten kann, hat Macht.
Prinzip 3: Macht entsteht aus Koalitionen
Niemand ist allein mächtig. Auch nicht der CEO.
Macht entsteht durch Allianzen, Loyalitäten, gegenseitige Unterstützung. Durch das Netzwerk derjenigen, die hinter Ihnen stehen, wenn es kritisch wird.
Die zentrale Frage ist deshalb nicht: Wie kompetent bin ich? Sondern: Wer ist bereit, für mich Risiken einzugehen?
Das bedeutet nicht, dass Sie allen gefallen müssen. Im Gegenteil. Die mächtigsten Menschen haben oft auch entschiedene Gegner. Aber sie haben eine stabile Koalition von Unterstützern, auf die sie sich verlassen können.
Diese Koalitionen entstehen nicht zufällig. Sie werden aufgebaut:
- Durch Reziprozität: Sie unterstützen andere, damit diese Sie unterstützen
- Durch geteilte Interessen: Sie identifizieren gemeinsame Ziele und arbeiten darauf hin
- Durch Verlässlichkeit: Sie tun, was Sie sagen - auch wenn es unbequem ist
- Durch strategische Positionierung: Sie machen sich für die richtigen Menschen wertvoll
Macht ohne Koalition ist Scheinmacht. Sie hält nicht.
Die dunkle Seite: Wenn Macht missbraucht wird
An dieser Stelle werden viele sagen: "Das klingt nach Machiavelli. Das klingt nach Manipulation. Ist das wirklich, wie ich führen will?"
Die Frage ist berechtigt. Denn diese Prinzipien können missbraucht werden.
Macht missbrauchen bedeutet:
- Abhängigkeiten schaffen, nur um andere zu kontrollieren
- Informationen zurückhalten, nur um sich unersetzbar zu machen
- Koalitionen gegen andere schmieden, nur um persönliche Rivalen zu schwächen
Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, mit Macht umzugehen.
Macht ethisch nutzen bedeutet:
- Abhängigkeiten verstehen, um Lösungen zu finden, die für alle funktionieren
- Informationen teilen, wo es der Sache dient - und zurückhalten, wo es nötig ist
- Koalitionen bilden, um Dinge zu bewegen, die allein nicht möglich wären
Der Unterschied liegt nicht in den Mechanismen. Der Unterschied liegt in der Absicht und im Zeithorizont.
Kurzfristiges Eigeninteresse auf Kosten anderer: Machtmissbrauch.
Langfristige Ziele, die mit den Zielen der Organisation übereinstimmen: Machtnutzung.
Oder anders formuliert: Ethische Machtausübung gelingt dann, wenn Impact (Wirksamkeit) und Integrität (Legitimität) in Balance bleiben. Sie nutzen Ihre Macht, um Dinge zu bewegen - aber auf eine Weise, die auch bei transparenter Betrachtung Bestand hätte.
Die Grenze ist nicht immer scharf. Aber sie existiert.
Was das für Sie bedeutet
Wenn Sie in Ihrer Organisation etwas bewegen wollen - echte Veränderungen, nicht nur Symbolpolitik - dann müssen Sie aufhören, Macht als abstraktes Konzept zu behandeln.
Sie müssen stattdessen drei Fragen beantworten:
1. Wer ist auf mich angewiesen - und wofür?
Identifizieren Sie Ihre faktischen Machtquellen. Oft liegen sie nicht dort, wo Sie denken.
Wenn Sie keine klare Antwort auf diese Frage haben, dann haben Sie ein Problem. Denn ohne Abhängigkeiten haben Sie keine Verhandlungsmasse.
Die Lösung ist nicht, künstliche Abhängigkeiten zu schaffen. Die Lösung ist, sich für die richtigen Menschen wertvoll zu machen.
2. Welche Informationen brauche ich - und von wem?
Macht bedeutet nicht, alles zu wissen. Macht bedeutet, das Richtige zur richtigen Zeit zu wissen.
Bauen Sie Kanäle auf, über die Sie früher und besser informiert werden als andere. Das müssen nicht offizielle Kanäle sein. Oft sind es die informellen Gespräche, die entscheidenden Einblick geben.
Aber Vorsicht: Informationen zu sammeln, ohne sie zu nutzen, bringt nichts. Die Kunst liegt darin, zu wissen, welche Informationen relevant sind - und welche nur Rauschen.
3. Wer muss hinter mir stehen, damit meine Initiative Erfolg hat?
Macht ist kein Soloprojekt. Identifizieren Sie Ihre kritischen Stakeholder. Nicht die offensichtlichen - die versteckten.
Wer kann Ihr Vorhaben blockieren, ohne dass es jemand bemerkt? Wer hat informellen Einfluss auf die Entscheider? Wer könnte ein natürlicher Verbündeter sein, wenn Sie ihn richtig einbinden?
Und dann: Sprechen Sie mit diesen Menschen. Nicht als Bittsteller. Nicht als Verkäufer. Sondern als jemand, der verstanden hat, dass Macht gemeinsam entsteht.
Macht ist kein schlechtes Wort
Das größte Problem, das ich bei Führungskräften sehe, ist nicht, dass sie zu viel Macht wollen. Sondern dass sie zu wenig über Macht nachdenken.
Sie scheuen das Wort. Sie sprechen lieber von "Einfluss", "Leadership", "Gestaltung". Als wäre Macht etwas Schmutziges, das man nicht beim Namen nennen darf.
Aber diese Vermeidung hat Konsequenzen.
Wer Macht ignoriert, wird zum Spielball derjenigen, die sie verstehen. Sie werden übergangen, ausmanövriert, für fremde Interessen eingespannt - ohne es zu merken.
Die integren, fähigen Menschen, die ich scheitern sah, hatten keine schlechten Absichten. Aber sie durchschauten die Machtdynamiken nicht und hielten ihre Naivität für Anstand.
Aber es ist kein Anstand, sich aus Machtfragen herauszuhalten. Es ist Verantwortungslosigkeit.
Denn wenn Sie Dinge in Ihrer Organisation bewegen wollen - wenn Sie Missstände beheben, Innovationen durchsetzen, Menschen fördern wollen - dann brauchen Sie Macht.
Nicht um Ihrer selbst willen. Sondern um der Sache willen.
Die eigentliche Frage
Am Ende steht nicht die Frage: Soll ich Macht anstreben?
Die Frage lautet: Wozu nutze ich die Macht, die ich habe?
Denn Sie haben Macht. Jeder hat Macht. Die Frage ist nur, ob Sie sie erkennen und bewusst einsetzen - oder ob Sie sie anderen überlassen.
Die klassischen Macht-Modelle geben darauf keine Antwort. Sie beschreiben Macht als Zustand, nicht als Prozess. Als etwas, das man besitzt, nicht als etwas, das man gestaltet.
- Macht entsteht aus Abhängigkeiten, die Sie verstehen müssen.
- Macht entsteht aus Informationen, die Sie sich erarbeiten müssen.
- Macht entsteht aus Koalitionen, die Sie aufbauen müssen.
Das ist mühsam. Das ist politisch. Das ist manchmal frustrierend.
Aber es ist die Realität.
Und wenn Sie diese Realität nicht akzeptieren, werden Sie scheitern - egal wie gut Ihre Ideen sind.
Drei konkrete nächste Schritte:
1. Analysieren Sie Ihre Machtquellen
Nehmen Sie sich 30 Minuten. Schreiben Sie auf: Wer ist auf Sie angewiesen? Wofür? Wo haben Sie selbst Abhängigkeiten? Seien Sie schonungslos ehrlich.
2. Identifizieren Sie Ihre Informationslücken
Was müssten Sie wissen, um in Ihrer Organisation wirksamer zu sein? Wer hat diese Informationen? Wie können Sie Zugang bekommen?
3. Kartieren Sie Ihre Stakeholder
Für Ihr wichtigstes Vorhaben: Wer muss hinter Ihnen stehen? Wer könnte blockieren? Mit wem haben Sie noch nicht gesprochen?
Falls Sie dabei Unterstützung brauchen - jemanden, der Ihre konkrete Situation von außen betrachtet und mit Ihnen die Macht- und Stakeholder-Dynamiken durchdenkt - biete ich einen Power Call an:
60 Minuten, in denen wir Ihre spezifische Konstellation analysieren.
Keine Theorie aus Lehrbüchern. Nur die Realität Ihrer Organisation - und wie Sie darin wirksam werden.
Markus Krahnke | OFFICEPOLITICS®
Executive Coach für Macht- und Stakeholder-Dynamiken
25 Jahre Erfahrung in Politik & Konzernen